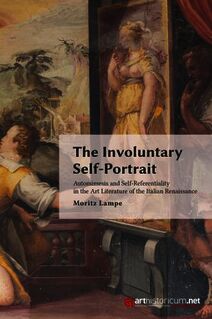Das künstlerische Individuum hat wieder Konjunktur. Nachdem sich auch die Kunstgeschichte, wie alle anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, in den vergangenen Jahrzehnten primär auf Strukturen und Theorien konzentriert und den handelnden Künstler häufig genug vernachlässigt hat, scheint es ganz so, als ob die Künstlergeschichte, die ja überhaupt am Anfang aller Kunsthistoriographie stand, sich wieder eines gestiegenen intellektuellen Interesses erfreut. Nicht im Geiste des hagiographischen Geniekults des 19. Jahrhunderts freilich, der nicht unerheblich zu deren Kontaminierung beigetragen hat, sondern eher gespeist aus anthropologischer Neugier. Mit einher geht dabei notwendig auch die verstärkte wissenschaftliche Hinwendung zur Gattung des Selbstporträts in der europäischen Kunst, zu der nach wie vor eine übergreifende, systematische Darstellung vermisst werden darf. Einschlägige Studien dazu sind allerdings in Arbeit, und kurz vor seinem Abschluss steht zudem das vielversprechende, von Lukas Madersbacher an der Universität Innsbruck geleitete Forschungsprojekt „Metapictor. Integrierte Selbstbildnisse in der Malerei des 15. Jahrhunderts“, das die Untergattung der in größere, andere Bilderzählungen eingebettete Selbstporträts in einer ihrer entscheidenden Phasen untersucht; in naher Zukunft wird von dort auch eine einschlägige Datenbank öffentlich zugänglich gemacht werden:
https://www.uibk.ac.at/projects/metapictor/projekt.html.de
Im Selbstporträt wird der grundsätzliche paradoxale Status des Porträts, der darin beruht, allein indexikalisch zu operieren, also auf etwas zu verweisen, was jenseits des eigenen Formats liegt, aufgehoben, wird das Werk mit sich selbst identisch. Zu Porträt und noch weniger zum Selbstporträt hat sich weder in der Frühen Neuzeit noch danach eine veritable Theorie ausgebildet, das erklärt vielleicht die Schwierigkeit im Umgang mit der Gattung, in jedem Fall aber macht sie dieser Umstand zu einer steten und besonderen Herausforderung.
Das Selbstbildnis steht auch im Zentrum von Moritz Lampes hier angezeigtem Buch, das aus seiner 2015 an der Florentiner Università degli Studi verteidigten Dissertation hervorgegangen ist, und die er nun in englischer Sprache vorlegt. Dabei versteht Lampe das Selbstbildnis allerdings im ganz umfassenden Sinne, mehr als integrales Selbstbild also, da es ihm nicht um die spezifische Bildgattung, als vielmehr um die Selbstkonstitution des frühmodernen Künstlers geht, so wie sie sich namentlich in der Kunstliteratur der Zeit artikuliert. Dabei leitet ihn die Überzeugung, dass zumal in der Frühen Neuzeit sich die Vorstellung von der Gleichsetzung von Künstler und Werk durchsetzt, sich dessen Persönlichkeit gleichsam im Werk – und nicht allein im Selbstporträt – einlagert, und dass dieser Prozess, nicht linear und durchaus auch mit Rückzügen und Anfeindungen, zugleich die Emanzipation hin zum autonomen Künstler begleitet. „Ogni pittore dipinge sé“ lautet das wohlbekannte, alte toskanische Sprichwort, das namentlich durch Leonardo da Vinci bekannt gemacht, von diesem allerdings als Vorwurf formuliert worden ist; Letzterem ging es dabei um die Vermeidung einer solchen Selbsteinschreibung des Künstlers in sein Werk und um die Zurückdrängung jedweden Personalstils.
Lampes Quellen sind Traktate und Biographien, Lyrik, Briefe und andere schriftliche Zeugnisse, dazu aber auch Gemälde, Graphik oder Skulptur, und zwar dort, wo sich in ihnen Kommentare zu diesem Phänomen identifizieren lassen. In sieben Kapiteln entwickelt er seine These, ausgehend von antiken Beispielen, namentlich von der Überzeugung des Komödiendichters Aristophanes, wonach ein Autor – auch seine Erscheinungsweise insgesamt – mit seinem Bühnenwerk identisch seien. In der Folge erörtert Lampe die Frage nach dem Personalstil, die individuelle Manier also, und wie darüber die eigene Mimesis ins Werk findet. Oder eben, wie das verhindert werden und ein Werk mit universalistischem Anspruch geschaffen werden kann. Neben Cennino Cennini und Leon Battista Alberti ist ihm hierzu natürlich Leonardo der eigentliche Gewährsmann, nicht zuletzt aber auch Paolo Pino, der nicht häufig, und das zu Unrecht, herangezogene venezianische Maler und Autor, dessen 1548 erschienener Dialogo di pittura zentral auf diese Problematik eingeht – Pino hält die Einlagerung der künstlerischen Physis in die Malerei gleichsam für unhintergehbar, was letztlich zu einer gewagten Forderung nach der körperlichen Beschaffenheit des Künstlers schlechthin führt. Zu Recht wird hier bei der Beschäftigung mit diesem Thema auch Albrecht Dürer angeführt; er hat, neben Leonardo, die Durchsetzung normativer Gesetze, zumal bei der Darstellung der menschlichen Proportion, wohl am Systematischsten verfolgt. Die Art, wie Lampe diese sehr komplexe Debatte – die im deutschsprachigen Raum von Wolfgang Brückle bereits für die Epochenschwelle um 1500 knapp aber durchaus erhellend dargestellt worden war[1] – hier quellengesättigt und mit einlässlicher Kommentierung ausbreitet, ist ebenso überzeugend wie hilfreich; auf lange Sicht dürfte das der entscheidende Beitrag dazu bleiben. Und doch darf ein Manko nicht unerwähnt bleiben; auch Moritz Lampe führt in seiner Bibliographie den Autor Heinz Knobeloch nicht auf, dessen extrem anregende, philosophisch grundierte Studie zur Frage der künstlerischen Selbstbehauptung ja in der jüngeren kunsthistorischen Literatur überhaupt hartnäckig übersehen wird.[2]
Die dem Phänomen der Selbsteinlagerung des künstlerischen „Selbsts“ inhärente Gefahr der Wiederholung und den daraus resultierenden Mangel an „Varietas“, erörtert Lampe in der gebotenen Ausführlichkeit am Beispiel Pietro Peruginos, der ja bekanntlich schon den Zeitgenossen diesbezüglich unangenehm aufgefallen war. Und er befragt Vasaris Vite eingehend nach dem dort beschriebenen Verhältnis von „physiognomischer Prokreation“ – souverän gestützt auf Ulrich Pfisterers einschlägige Untersuchung[3] – und der Forderung nach übergeordneten, universalistischen Prinzipien, die an die Malerei zu stellen seien. Am Beispiel von Daniele da Volterras 1547/48 entstandenen, später zerstörten Stucco-Reliefs in der Orsini-Kapelle in S. Trinità dei Monti in Rom, untersucht Lampe anschließend beispielhaft, wie dieser Anspruch, also die Überwindung der quasi naturgegebenen Selbsteinschreibung, durch den Einsatz „objektiver“ Muster ins Werk zu setzen versucht wurde; dass Michelangelos Einfluss hier unvermeidlich war, macht dieses Exempel besonders aufschlussreich.
Am konfliktgeladenen Verhältnis zwischen Vincenzio Borghini, dem ersten „Luogotenente“ der 1563 gegründeten Florentiner Accademia del Disegno, und Benvenuto Cellini, gelingt Lampe dann eine besonders anschauliche Darstellung des grundsätzlichen Disputs zwischen Theorie und Praxis. Borghinis Unnachgiebigkeit, mit der er Künstler vom „Philosophieren“ abhalten wollte, in ihre Schranken wies und auf der gehorsamen Befolgung handwerklicher Regeln bestand, fand in Cellini ihren lebhaftesten Gegner. Schon in seinem schriftlichen Beitrag zu Benedetto Varchis Umfrage, den Rang der Künste betreffend, also zum „Paragone“, hatte Cellini ja darauf bestanden, dass der Künstler über ein gleichsam enzyklopädisches Wissen nicht nur zu verfügen, sondern dieses tatsächlich zu „verkörpern“ habe – ein Musiker müsse er sein, ein Krieger oder auch ein Dichter, um überhaupt glaubhaft solche Figuren darstellen zu können. Dass der Künstler überdies in seiner ganzen Leiblichkeit in seinem Werk sich spiegele, also durchaus nicht physiognomisch allein, ist eine Grundüberzeugung Cellinis – der Autor, der hier schreibt, hat das jüngst in zwei Monographien darzustellen versucht.[4] Und auch dass diese integrale Mimesis im Werk die entscheidende Vorstufe zur Künstlerautonomie darstellt, ist an keiner Figur exemplarischer abzulesen, als an Cellini – an seinen Skulpturen ebenso, wie an seinen Schriften, namentlich der Vita. Denn wenn Lampe vom „unfreiwilligen“ Selbstporträt spricht, also die Selbsteinlagerung als eine quasi unbewusste, aus natürlichem Impuls erfolgte Spiegelung, dann wandelt sich das spätestens mit Cellini, der ganz bewusst sein Werk und sein Ich gleichsetzt. Dass er so geschickt im Goldschmiedehandwerk operiere, erklärt er (im 26. Kapitel des ersten seiner in zwei Bücher unterteilten Vita) beispielsweise, verdanke sich allein der Tatsache, dass er von der göttlichen Natur ausgestattet gewesen sei „… d’una complessione tanto buona e ben proporzionata, che liberamente io mi prommettevo dispor di quella tutto quello che mi veniva in animo di fare.“ Der Begriff „Complessione“ ist von Goethe, in seiner folgenreichen Übersetzung der Vita, mit „Komplexion“ wiedergegeben, also nicht übersetzt worden; John Addington Symonds hat ihn in seiner bis heute maßgeblichen Übertragung von 1887 mit „Temperament“ übersetzt, und Jacques Laager in der jüngsten deutschen Ausgabe von 2001, mit „Talent“. Dabei bedeutet „complessione“ im Italienischen nichts anderes als „corporatura“, Körperbau also. Der wohlproportionierte Leib Cellinis, das teilt er so mit, habe ihn überhaupt erst in die Lage versetzt, über all das, was ihn beseelte, zu verfügen. Mit Cellini wird die Automimesis zum künstlerischen Programm.
Das formuliert Lampe in dieser Deutlichkeit in seinem Buch nicht. Gleichwohl beendet er es mit einem Kapitel, das diese wechselseitige Entsprechung von Künstler und Werk sich in der Forderung der Gegenreformation sich durchsetzen sieht. Diese forderte ja den „artifice cristiano“, also den gläubigen Künstler, der nur als solcher auch christlich durchdrungene und so für die religiöse Propaganda taugliche Bilder schaffen könne. Erst in der Ironie, dass die auf überindividuelle Frömmigkeit zielende katholische Propaganda damit die Identität von Maler und Werk sanktionierte, sieht Lampe das autonome Künstlerindividuum sich durchsetzen.
Man liest Lampes Studie – das Englische trägt nicht unerheblich bei zu deren klarem Duktus – mit großem Gewinn. Wenn er selbst auch betont, keine allumfassende Geschichte der Automimesis vorlegen zu wollen, so gelingt es ihm doch, das Phänomen an kapitalen Beispielen so zu fassen, dass man mit Fug und Recht behaupten darf, es sei hier erstmals systematisch erschlossen worden. Mit allen Folgen, die das für die weitere Beschäftigung mit der unabschließbaren Frage nach der Autonomie der Kunst, vor allem aber auch für die längst überfällige Auseinandersetzung mit deren körpertheoretischen Bedingungen zuversichtlich haben wird.
--
[1] Wolfgang Brückle: „Personalstil als Makel der Kunst zu Anfang des Cinquecento“, in: Michael Brunner (Hg.): Stil und Stilpluralismus in den Künsten des 16. Jahrhunderts, Engen 2004, S. 63-80.
[2] Heinz Knobeloch: Subjektivität und Kunstgeschichte, (Kunstwissenschaftliche Bibliothek, hrsg. von Christian Posthofen, Band 4), Köln 1996, siehe vor allem S. 66-85.
[3] Ulrich Pfisterer: Kunst-Geburten. Kreativität, Erotik, Körper, Berlin 2014.
[4] Andreas Beyer: Künstler, Leib und Eigensinn, Berlin 2022, sowie ders.: Cellini. Ein Leben im Furor, Berlin 2024.
Moritz Lampe: The Involuntary Self-Portrait. Automimesis and Self-Referentiality in the Art Literature of the Italian Renaissance, Heidelberg: arthistoricum.net 2022
ISBN-13: 978-3-9850110-5-6, PDF, Inhaltsverzeichnis
Empfohlene Zitation:
Andreas Beyer: [Rezension zu:] Moritz Lampe: The Involuntary Self-Portrait. Automimesis and Self-Referentiality in the Art Literature of the Italian Renaissance, Heidelberg 2022. In: ArtHist.net, 21.10.2024. Letzter Zugriff 28.02.2026. <https://arthist.net/reviews/42979>.
![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.
Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.