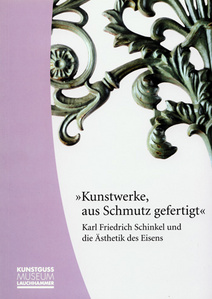Während Karl Friedrich Schinkel und die preußische Eisengießerei im Berlin-Brandenburgischen Umfeld bestens bekannt sind - zumal im Jahr des festlich begangenen 225. Schinkel-Geburtstags -, genießen das Kunstgussmuseum und die Eisengießerei in Lauchhammer in der Niederlausitz derzeit ein ungleich geringeres Interesse - zu Unrecht, wie der Zusammenhang mit Schinkel und die hier zu besprechende Ausstellung nebst zugehörigem Begleitband einmal mehr belegen.
Als Spezialmuseum widmet sich das Kunstgussmuseum des traditionsreichen Eisenwerkes in Lauchhammer dem Eisenguß und seinen technischen Entwicklungen. Anders als in Überblicksmuseen mit Sammlungen kunstgewerblicher Erzeugnisse aus Eisen liegt hier der Fokus nicht nur auf dem Kunstguß, sondern richtet sich ebenso auf die technischen und sozialen Implikationen des Eisengusses wie auf seinen innovativen Charakter in Großindustrie und Architektur.
Auch wenn Schinkel selbst Lauchhammer nie aufgesucht hat, ist es vielmehr das Anliegen der Kuratoren, die Nutzung und die Beschäftigung mit dem Material des 19. Jahrhunderts in Schinkels Werk zu thematisieren. Erfreulich dabei ist, daß mit einem großzügigen Blick über die Stadtgrenzen hinaus der Dialog mit allgemeinen Entwicklungen und die Rückwirkungen der ästhetischen Auseinandersetzung auf Werke wie das Eisenwerk Lauchhammer thematisiert werden.
So ist dies also eine Ausstellung zum Eisen im Werk Schinkels, zugleich aber auch eine eindrucksvolle Demonstration zu technischen Bedingungen und Voraussetzungen der Nutzung des Materials. Hierbei ergibt sich eine inhaltliche Klammer zwischen dem Umstand, daß das damals zu Sachsen gehörige Lauchhammer im späten 18. Jahrhundert dem preußischen Eisenguss voranging - zumindest soweit es den künstlerischen Eisenguss betrifft -, zugleich aber auch in die Bemühungen zur Etablierung der preußischen Eisenindustrie in dieser Epoche fest eingebunden war.
Katalog wie Ausstellung gruppieren sich um folgende Themenkomplexe: Eisen als nationales preußisches Material in den Befreiungskriegen seit 1813 mit der Stiftung des Eisernen Kreuzes durch Friedrich Wilhelm III. (Martin H. Schmidt, 25-31), Schinkels Englandreisen und die Folgen für das Bauen mit Eisen in Deutschland (Elsa von Wezel, 32-41), Bedeutung von Materialien in Baukunst und Restaurierung, Herstellung und Oberflächengestaltung (Jörg Freitag, 42-45) sowie die formale Gestaltung kunstgewerblicher und architektonischer Erzeugnisse und ihre Systematisierung in den Vorlagen für Künstler und Handwerker. Einen einleitenden Überblick zum Gesamtthema gibt Susanne Kähler (6-24).
Auf der eher kleinen Wechselausstellungsfläche des Museums in Lauchhammer wird für das Ausstellungsthema zurecht keine Vollständigkeit angestrebt. Vielmehr werden durch eine exemplarische Objektauswahl und subtil-didaktische Besucherführung zentrale Punkte zum Thema erläutert. Es sind gewissermaßen die sorgfältig ausgewählten Kleinigkeiten, Details aus Schinkels Meisterwerken, die, sonst leicht zu übersehen, hier nun dem Betrachter das Thema erschließen. So werden etwa nicht nur die üblichen Darstellungen des Kreuzbergdenkmals als einem der Hauptwerke Schinkels in Eisen präsentiert, sondern vor allem einige originale Fragmente mit Resten der Farbfassung. Von Schinkels Altem Museum in Berlin werden die Buchstaben der Inschrift gezeigt. Besonders interessant bei dieser Sichtbarmachung des sonst unbeachteten Details ist die innere Eisenbewehrung der Pegasoi auf dem Dach des Alten Museums, die bei der Restaurierung entfernt wurden. Sie ist ein eindrucksvolles und zudem das größtes Objekt der Ausstellung, das auf den ersten Blick wie eine skurrile, moderne Skulptur wirkt.
Nicht nur hier, sondern besonders auch im Abschnitt über die architektonische Verwendung des Eisens wird das Wechselverhältnis und die gegenseitige Bedingtheit von äußerem Erscheinungsbild einer Skulptur bzw. Architektur einerseits und dem dahinter befindlichen eisernen Gerüst greifbar. Insbesondere für die Architektur wird dieser ‚Konflikt’ im Katalog ausführlicher kommentiert (32-41). Die Betonung liegt dabei auf Schinkels Ablehnung der rein konstruktiven Eisenbauten der englischen Großindustrie. Zwar suchte er offenbar nach Möglichkeiten der Integration der neuen Bautechnik, jedoch ohne seine Architekturformen in ihre Abhängigkeit zu bringen. Schinkels Nachfolger nutzten dann die umfangreichen Möglichkeiten, um mit Eisen als Baumaterial in seiner ganzen Verwendungs- und Gestaltungsvielfalt zu experimentieren. So wurden die Voraussetzungen für die Entwicklung der Schwerindustrie im 19. Jahrhundert geschaffen.
Mit dieser Ausstellung stattet Schinkel sozusagen mit 200 Jahren Verspätung Lauchhammer den überfälligen Besuch ab. Ein Besuch der Dauerausstellung des Kunstgussmuseums in Lauchhammer rundet das Thema ab. Auch die heute noch tätige Kunstgießerei kann auf Voranmeldung hin besichtigt werden.
Kunstgussmuseum Lauchhammer
Grünhauser Straße 19
01979 Lauchhammer-Ost
Öffnungszeiten: Di.-So. 13.00-17.00
0049-3574-850166
Lauchhammer Kunstguß GmbH & Co KG
Freifrau v. Löwendahl Str.
01979 Lauchhammer - Ost
Tel.:0049-3574-8851-0
Führung in der Kunstgießerei nach vorheriger telefonischer Absprache.
Stiftung Kunstgussmuseum Lauchhammer, Red. Susanne Kähler (Hrsg.): "Kunstwerke, aus Schmutz gefertigt". Karl Friedrich Schinkel und die Ästhetik des Eisens., Kunstgussmuseum Lauchhammer : Selbstverlag 2006
48 S. 36 Abb.en, 5,00
Empfohlene Zitation:
Charlotte Schreiter: [Rezension zu:] „Kunstwerke, aus Schmutz gefertigt" Schinkel und die Ästhetik des Eisens (Kunstgussmuseum Lauchhammer, 02.09.–03.12.2006). In: ArtHist.net, 20.10.2006. Letzter Zugriff 21.01.2026. <https://arthist.net/reviews/459>.
![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.
Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.