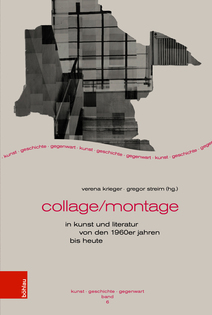Pablo Picasso und Hannah Höch, Kurt Schwitters, James Joyce und viele mehr: Sie alle nutzten die zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär werdenden Techniken von Collage und Montage, um auf überraschende Weise Bild- und Sprachkonventionen zu unterlaufen. Die Aufmerksamkeit, auf die diese Praxis zielte, konnte zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führen. Während Collage und Montage einerseits die Möglichkeit pluraler Realitäts- und Informationsebenen in einem Bild und/oder in einem Text bereitstellen, können sie mit ihren ungewöhnlichen Kombinationen andererseits aber auch ganz im Gegenteil drastische Vereindeutigungen herausarbeiten. So transportieren die Fotomontagen von John Heartfield oder die Filme von Sergej Eisenstein klare politische Aussagen ohne Zwischentöne. Setzten diese Künstler ihre Bildrhetorik ein, um zu enttarnen, arbeitete Leni Riefenstahl in ihren Propagandafilmen, die sie für das NS-Regime montierte, um zu verschleiern. Zeitgenossen wie Bertolt Brecht und Walter Benjamin erkannten: Collage und Montage sind Kunstformen von ausgesprochen heterogenem Charakter. So vielfältig ihre Ausdruckformen, so unterschiedlich auch die Bewertungen. [1]
Der Sammelband „Collage/ Montage in Kunst und Literatur von den 1960er Jahren bis heute“, den die Kunsthistorikerin Verena Krieger und der Literaturwissenschaftler Gregor Streim (beide Jena) als eine interdisziplinäre Publikation herausgegeben haben, knüpft hier an. Ausgehend von den Analysen der Zwischenkriegsjahre konstatieren sie in ihrer Einleitung, dass mit den neuen digitalen Möglichkeiten ein Nachjustieren der etablierten Theorien erforderlich ist. Zwar lassen sich aktuelle Phänomene wie das Sampeln, die Verwendung von Found-Footage oder das Kreieren von Memes auf künstlerische Praktiken des frühen 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Durch die allgemeine Verbreitung entsprechender Hard- und Software beschränken sich das Collagieren und Montieren jedoch nicht mehr allein auf die ästhetische Praxis. Sie sind vielmehr zu omnipräsenten Dokumentationsverfahren geworden, die möglicherweise neue Realitätskonzepte begründen. Beiträger:innen aus der Kunstgeschichte sowie den Literatur- und Medienwissenschaften gehen in insgesamt 13 Aufsätzen dieser Fragestellung nach, ein Gespräch von Verena Krieger mit der Künstlerin Katharina Gaenssler, die mit Fotocollagen Ausstellungsräume gestaltet, rundet diese Zusammenstellung ab. Auch wenn in der ausführlichen Einleitung betont wird, dass man Montage und Collage nicht eindeutig definieren kann (S. 8), sollen anhand von Fallbeispielen die ästhetischen Charakteristika der „[…] gestalterischen Verfahren in Kunst und Literatur, die auf der Fragmentierung, Dekontextualisierung und Neukombination vorgefundenen visuellen und/oder textlichen Materials basieren“(S. 8), herausgearbeitet und vorgestellt werden.
Thematisch ist das Spektrum der Aufsätze ausgesprochen weit gesteckt. Der Beispielkanon reicht von Konkreter Poesie Franz Mons (Paola Bozzi, Gregor Streim) und Konzepten vom Zufall bei Hans Magnus Enzensberger und Claude Simon (Sophie König) sowie Alexander Kluge (Steffen Andrae) über die Auseinandersetzung mit der Ausstellung filmischer Inszenierungen von Ulrike Ottinger (Tanja Zimmermann), den unterschiedlichen Fotomontagepraktiken von Martha Rosler (Annette Tietenberg), Marcel Odenbach und Thomas Hirschhorn (Verena Krieger) sowie John Stezaker (Florian Flömer) bis hin zu Hörspielen von Ferdinand Kriwet und Thomas Steinaecker (Heinz Hiebler), dem Umgang mit Erinnerung in Werken von Nora Krug (Gudrun Heidemann, Rüdiger Singer) sowie der Auseinandersetzung mit einem Vortrag des Literaten und Wissenschaftlers Walter Höllerer ( Reinhard M. Möller). Ein Blick auf verschiedene Bricolage-Techniken in aktivistischer Kunst (Karen van den Berg) rundet diese Vielfalt ab. Dabei ist die Verdichtung, die die Auseinandersetzung mit Werken von Mon und Krug durch jeweils zwei Aufsätze erfährt, ausgesprochen produktiv, entstehen durch die Zusammenstellung von Rahmen und Tiefenbohrung doch instruktive Einsichten, die über die konkreten Beispiele hinausgehen. Aber auch in anderen Fällen ergeben sich Synergien zwischen den einzelnen vorgestellten Beispielen, etwa zwischen den Texten von Annette Tietenberg und Verena Krieger, die sich beide mit politisch motivierten Fotomontagepraktiken beschäftigen, oder den Aufsätzen von Sophie König und Reinhard M. Möller, die provozierte wie unvorhersehbare Zufälle zum Thema haben.
Begreift man die Publikation nicht nur als eine Zusammenstellung interessanter Forschungsperlen, sondern als eine aktuelle Ausgangsbasis für weitere Reflexionen über Collage und Montage, so fällt der begrenzte Fokus auf, der den Horizont der Beispiele bestimmt. Dies betrifft nicht nur das gänzliche Fehlen von Beispielen aus Gesellschaften, in denen, wie in den sozialistischen und faschistischen bzw. diktatorisch regierten Staaten Europas, die Freiheit der Kunst jahrzehntelang stark eingeschränkt war und Collagen und Montagen für subtil subversive Aussagen genutzt wurden. Wenn wir in den Kunst-und Kulturwissenschaften aktuell darüber nachdenken, wie wir in der Vergangenheit vernachlässigte und ausgegrenzte Perspektiven mit gleichwertiger Stimme integrieren können, wäre es zudem zeitgemäß, zumindest mit einem Beispiel eine nicht-eurozentrische Position mitzuberücksichtigen. Wie wurde sich in den Rassismus- und Kolonialismusdiskursen der kombinatorischen Techniken bedient? Gab es hier Bildrhetoriken, die sich nicht aus den eurozentrischen Traditionen speisten?
Auch der zeitliche Rahmen des Sammelbandes ist – nicht zuletzt mit Blick auf die notwendige Neuorganisation unseres Wissens – problematisch. Zwar war es in der Kunstgeschichte längere Zeit üblich, mit 1960 einen maßgeblichen Einschnitt zu setzen. Nimmt man die ästhetischen Ausdrucksformen, die mit Collage und Montage arbeiten, in den Blick, ist es jedoch ausgesprochen aufschlussreich, die 1940er und 1950er Jahre mit einzubeziehen, in denen sich Bild-, Sprach- und Filmkünstler:innen mit der Politik und den daraus resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen auseinandersetzten. Die Veränderungen auf dem Feld der technologischen Entwicklung – ein Faktor von Krieger und Streim für den gewählten Zeitrahmen – waren vor 1960 genauso Gegenstand heißer Diskussionen wie danach; die Digitalisierung erfolgte in den Künsten sowieso erst um einiges später.
Aber auch ohne zusätzliche Aufsätze hätte man durch kleine Einlassungen in Einleitung und in den Aufsätzen auf die Zeit zwischen 1940 und 1960 verweisen können: Kurt Schwitters etwa, der in verschiedenen Texten als wichtige Referenz genannt wird, arbeitete nicht nur in Deutschland und im deutschsprachigen Umfeld. Mit seiner Emigration nach Norwegen versuchte er dort und später in England neu und anders Fuß zu fassen und dabei seine Ausdrucksformen neu zu konturieren.[2] Spaltungen im Surrealismus, die durch die erzwungenen Emigrationen aus Europa einerseits und die Kriegserfahrungen in Europa andererseits begünstigt wurden, verhandelten das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gegenüber der Vorkriegspraxis neu. CoBrA, die 1948 gegründete, intermedial arbeitende Gruppe von Künstler:innen, nutzte hierzu in verschiedenen Medien ausgiebig Collage und Montage.[3] Die Vereinigung existierte zwar nur wenige Jahre, war dafür aber besonders produktiv und blieb auch nach ihrer Auflösung in den frühen 1950er Jahren ein wichtiger Bezug, nicht zuletzt für die Gestaltung von Künstler:innenzeitschriften, Künstler:innenbüchern oder Ausstellungsdisplays; vieles aus der Zeit nach 1960 stellt eine Fortsetzung dieser Praktiken dar. Auch die Mitglieder der 1957 gegründeten Situationistischen Internationale, die ihrerseits zum Teil aus den Lettristen – Nachkriegs-Repräsentant:innen einer Konkreten Poesie – hervorgegangen war, beschäftigten sich bereits mit zahlreichen der Themen, die in der Publikation verhandelt werden.[4]
Der Sammelband kann zu der Annahme verleiten, nach 1960 werde eine vor dem Zweiten Weltkrieg angelegte Traditionslinie fortgeführt bzw. mit ihr gebrochen, während die Zeit dazwischen nebulös und offenbar für die Forschung uninteressant bleibt. Tatsächlich jedoch fehlt mit dieser Zeitspanne ein wichtiges Bindeglied, das manche Traditionen, aber auch die Ausbildung verschiedener Facetten plausibel machen kann. Allein Annette Tietenberg erwähnt am Rande, dass etwa in den USA strukturell andere Bezugsrahmen existieren als die aus Europa bekannte Geschichte (S. 146). Sie resultieren, das sei hier nachgetragen, nicht zuletzt durch die erzwungenen Emigrationen, die es keineswegs nur in die USA gab. Diese Differenzen, aber auch ihre Verbindungen mit in Europa ausgebildeten Traditionen für weiterführende Forschungsfragen herauszuarbeiten, bleibt Aufgabe zukünftiger Beschäftigungen mit dem Thema.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass der Sammelband „Collage/ Montage in Kunst und Literatur von den 1960er Jahren bis heute“ hierzu einen anregenden Auftakt liefert. Die Aufsätze erscheinen wie Spitzen von Eisbergen, deren mögliche Zusammenhänge es weiter zu erkunden gilt. Die Kritikpunkte, die mit Blick auf den Zeitrahmen und den Eurozentrismus die Konzeption der Zusammenstellung betreffen, zeigen an, welche Felder es für die grundlegenden Diskussionen zu diesem Thema einzubeziehen gilt und welche Bereicherungen auf uns warten. Ein Anfang ist gemacht.
Verweise:
[1] Vgl. Bertolt Brecht: „Anmerkungen zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny‘ “ (1930). In: Ders.: Werke. Große, komm. Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hg. Werner Hecht u.a., Bd. 24, Berlin u.a. 1991, S. 74-85. Walter Benjamin: „Was ist episches Theater?“ (2) (1939). In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hg. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Bd. 2/II, Frankfurt/ Main 1991, S. 531-539.
[2] Vgl. Leonie Krutzinna: Der norwegische Schwitters. Die „Merz“-Kunst im Exil. Göttingen 2019.
[3] Vgl. Karen Kurczynski: The Cobra Movement in Postwar Europe: Reanimating Art. New York, NY/ Abingdon 2021.
[4] Vgl. Roberto Ohrt: Phantom Avantgarde: eine Geschichte der Situationistischen Internationale und der modernen Kunst. Hamburg 1997. Anna Trespeuch-Berthelot: Internationale Situationniste: de l’histoire au mythe (1948-2013). Paris 2015.
Krieger, Verena; Streim, Gregor (Hrsg.): Collage/Montage in Kunst und Literatur von den 1960er Jahren bis heute, Köln: Böhlau Verlag 2024
ISBN-13: 978-3-412-52987-1, 252 Seiten, 55,00 Euro, Inhaltsverzeichnis
Empfohlene Zitation:
Barbara Lange: [Rezension zu:] Krieger, Verena; Streim, Gregor (Hrsg.): Collage/Montage in Kunst und Literatur von den 1960er Jahren bis heute, Köln 2024. In: ArtHist.net, 03.02.2025. Letzter Zugriff 28.02.2026. <https://arthist.net/reviews/43862>.
![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.
Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.