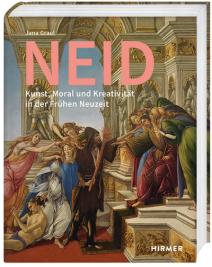Nach der Lektüre von Jana Grauls Dissertationsschrift gewinnt man den Eindruck, die gesamte Renaissance entfalte sich anhand eines einzigen Gefühls: Neid. Stets auf phänomenologischer Ebene wartet Graul mit einer enormen Bandbreite von Fallstudien auf, die sich über den beeindruckenden Zeitraum vom späten Duecento bis in das Ende des 17. Jahrhunderts erstrecken. Um diesen räumlich sinnvoll einzugrenzen, legt Graul ihren Schwerpunkt auf das humanistische Umfeld der Toskana und Florenz. Fall für Fall gräbt sich Graul unnachgiebig durch die vielfältigen Neiddiskurse, analysiert dessen bildliche Darstellungen und spannt ein Netz aus antiken Quellen, mittelalterlicher Scholastik und humanistischer Zeugnisse. Graul meistert die komplexen Zeitsprünge, indem sie bereits zu Beginn die Prüfsteine der Neid-Ikonografie setzt, auf deren vertraute Elemente sie im Ritt durch die Jahrhunderte stets zurückkommt: Graul beginnt bei Giottos Invidia, führt über Mantegnas „Kampf neidischer Urkünstler“ zurück zu Giovanni Pisanos Inschrift auf der Kanzel des Pisaner Domes hin zu Leonardos Virtù-Invidia-Zwitterwesen. Eine Zäsur setzt sie bei „Michelangelos Sieg über den Neid“ (223), dessen lauten Widerhall sie in Zuccharis Neidallegorie und Berninis Veritas nachhorcht. Graul zweiteilt demnach ihre Untersuchung in eine Neiddebatte im Florentiner Raum vor und nach den einschneidenden Veränderungen durch die Doppelspitze Michelangelos und Vasaris, die in Kunstwerk und Literatur den Neid final bezwingen. Die Auswahl des Korpus bildet dabei keinen „Höhenkamm“, sondern dient, ob stark oder schwach beforscht, dem gesetzten Ziel, das kulturhistorische Phänomen der Invidia nachzuzeichnen. Graul wirft mit den besprochenen Werken dennoch ein neues Licht auf die großen Meister und beweist ihre kunsthistorische Expertise an Malerei, Grafik, Fresken sowie Skulpturen. Die sieben Hauptkapitel werden kleinteilig untergliedert, machen das Werk übersichtlich und laden ein, es auch in den sich selbst tragenden Fallstudien zu lesen. Hierbei hilft insbesondere der umfangreiche, dreiteilige Index. Erst die sukzessive Lektüre macht aber das solide Fundament der Studie sichtbar, da Graul ihre untersuchten Werke stets auf ihre Vorgänger rückbezieht.
Ungezwungen skizziert Graul nicht gleich zu Beginn ihre Methode, den Aufbau und die Komplexität ihres Themas, sondern macht ihre Arbeitsweise einleitend praktisch nachvollziehbar. Erst gegen Ende des ersten Kapitels erläutert Graul den methodischen Wert des Neidbegriffs, der die antagonistische Logik frühneuzeitlichen Kunstschaffens auf den Punkt bringt. Graul beobachtet scharf, dass Invidia bloß eine Rolle hinter dem Vorhang zukommt und nie derart explizit, wie „Aemulatio“ oder „Paragone“ auf die literarische Bühne tritt. Insofern bietet der Neid eine Fläche, um die tatsächlichen Triebfedern – menschliche Gefühle – des künstlerischen Wettstreits erstmalig zu Tage zu fördern. Bei aller „Konjunktur der Emotionen“ (44) schränkt Graul wohlbedacht ein, inwiefern aus heutiger Sicht Gefühle in der frühen Neuzeit, als „dieselben“ rekonstruiert werden können.
Anhand des Mythos der Verleumdung des Apelles beschreibt Graul den Archetypus des Künstlerneids und die Rezeptionsgeschichte der Beschreibung Lukians von Apelles Gemälde. Antike Quellen und ihre frühneuzeitliche Verarbeitung werden gegenübergestellt. Eine eingehende Untersuchung widmet Graul dem Gründervater des Kupferstichs, Andrea Mantegna, der sich selbstironisch sowohl als Opfer des Neids, als auch in der Haut eines Täters zeigt. In Grauls Interpretation präsentiert sich Mantegna als einer der ambiguen, neidvollen Urkünstler vom mythischen Volk der Telchinen. Diese einerseits genialen Wesen – ihnen wird die Erfindung der Metallverarbeitung zugeschrieben – sind anderseits naturbedingt vom Neid zerfressen. Während seine Genossen aufeinander einschlagen, inszeniert sich Mantegna am Bildrand mit leuchtender Fackel und wendet sich vom durch Invidia ausgelösten Kampf ab. So verewigt sich der Künstler in seinem Kupferstich gar als Retter der Tugenden im neubenannten „Kampf neidischer Urkünstler“ (25). Graul leistet in ihrer Deutung des Selbstporträts im Telchinen-Kampf einen großen Beitrag zur Mantegna-Forschung. Die Strahlkraft des Kupferstichs, so Graul, kann für Mantegnas Nachfolger nicht hoch genug eingeschätzt werden.[1] Nicht Mantegna, sondern Giotto bildet aber den ersten Meilenstein in Grauls Ikonografiegeschichte. Giottos Invidia wird Caritas gegenübergestellt und dient als hervorragende Grundlage für fortführende Studien (132f.).[2]
Im zweiten Kapitel spürt Graul der Rolle des Gelehrtenneids nach, durchforstet einschlägige, humanistische Texte von Villani, Dante, Boccaccio, Petrarca, und Alberti und vollzieht die Begriffsentwicklung zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit nach. Gerade Florenz wird als „Sündenmoloch“ vorgestellt: das Bürgertum sei „Hochmut, Neid und Geiz“ (61) verfallen und zieht sogar Gottes Zorn auf sich, als die Stadt 1310 mit einer Hungersnot gestraft wird. Graul skizziert sodann die theologische „Krise“ um einen einheitlichen Sündenkanon. Es war Francesco Petrarca, der den Neid in seiner Scipio-Biografie zum Erzfeind der Tugend erhoben und diese Idee einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat (64). Sich als Opfer Invidias zu inszenieren, entwickelt sich zur Nobilitierungsstrategie, die das Werk der Literaten aufwertet – ein Mittel, das sich nicht nur Künstler aneignen, sondern auch Cosimo I. de’ Medici in seine Machtpolitik einführen wird.
Das dritte Kapitel behandelt Neid im Kontext von Lohn- und Ehrvorstellungen anhand des mittelalterlichen Präzedenzfalls Giovanni Pisanos, der für seine Arbeit von dem Baubeauftragten der Opera Duomo in Pisa nicht nach Vereinbarung entlohnt wird. Prompt hält Giovanni seine beschnittene Ehre auf der Kanzel fest, die dem Betrachter wünscht, vom Neid verschont zu bleiben. Pisano positioniert seinen Namen in der Inschrift unmittelbar unterhalb des Judaskusses (116). Gerechter Lohn und Neid zeichnen sich ebenso in Filaretes Porta Argentea ab, deren Analyse Graul großen Platz einräumt, um eine ikonografische Verbindung zu Mantegnas Telchinen nachzuweisen. Filarete begegnet Invidia ähnlich wie Mantegna mit Humor, indem er sich – Invidia zum Trotz – im Reigentanz mit seiner Werkstatt inszeniert (144).
Gerade das vierte Kapitel weckt den Eindruck, dass der Neid nicht nur „ein“ Laster, sondern zur moralischen Größe des Bösen schlechthin herangewachsen ist. Anhand der eindringlichen Studie von Leonardos Zwitterwesen, das Neid und Tugend bzw. Ruhm in einer Figur vereint, führt der erste Abschnitt das frühneuzeitliche Gegensatzdenken ein (178). Leonardos Zeichnung zeigt in Grauls Analyse Apoll aus dessen Bauch Invidia herauswächst. Während Apoll ihr die Augen mit einem Ölzweig auszustechen versucht, sprießen ihm aus Invidias Mund Schlangen entgegen (154).
Mit dem von Lukas von Leyden entworfenen Kupferstich vom neidvollen Saul, der seinen Speer auf den Harfe spielenden David vor sich richtet, kann Graul eine verwandte Ikonografie sowohl für biblische Motive als auch für den nordalpinen Raum nachweisen (175). Rosso Fiorentinos „Furor“, in Grauls Interpretation „Livor“ (185), bildet einen weiteren Meilenstein in der Ikonografie der Neidallegorie: Die kastrierte, aufgeschreckte Figur dient als Sinnbild der Unfruchtbarkeit, die vom Laster hervorgebracht wird. Blindheit und Impotenz stehen Zeugungs- und Innovationskraft des virilen Künstlers gegenüber.
Gegen Ende des vierten und zu Beginn des fünften Kapitels kommt Graul anhand von Giorgio Vasaris Viten auf ihr wichtigstes Argument, denn in der Person Michelangelos vollzieht sich ein Novum: Michelangelo gelingt es durch sein (von Vasari attestiertes) tugendhaftes Leben als erster und einziger Künstler den finalen Sieg über den Neid zu erringen und steigt so zum beinah „märtyrerhaften“ Vorbild seiner Nachfolger auf. Gerade in Michelangelos Lebendigkeit sieht Vasari den gottgegebenen Beweis für dessen Tugend. Michelangelo genießt bereits zu Lebzeiten den Status „divino“ und bleibt im Gegensatz zu seinen Kollegen von Neid und der bösen Fortuna verschont. Ist für Leonardo und seine Vorgänger Invidia noch stets eine natürliche Nebenwirkung von Virtus, ein notwendiges Übel des Künstlerdaseins, bäumen sich die Künstler im Anschluss an Michelangelo zu Siegern über den Neid auf (251). Graul erörtert Michelangelos Nachleben eingehend im bildnerischen Werk von Vasari, Zucchari und Bernini. Gerade die Bedeutung von Veritas zwischen Chronos und Invidia (273) ist dabei zentral. Über die Zeit siegt die Wahrheit über den Neid. Chronos jedoch als den „neidischen Zahn der Zeit“ zu stilisieren zeigt, wie der Mensch seiner natürlichen Vergänglichkeit ein Laster unterstellt, aus Angst, dass nicht er, sondern auch seine Kunst der Zeit eines Tages zum Opfer zu fallen.
Das sechste Kapitel erzählt vom langen, ikonografischen Weg der Virtus und die Steine, die ihr unter anderen die schillernden Satyrn in den Weg legen. Sieht man die Mischwesen sowohl als ignorante „Kunstbanausen“ im Dienst des neidischen Chronos (351), vertreiben sie an anderer Stelle die Laster aus den Augen Bacchus’ (358). Folgerichtig erfährt sodann die Ignorantia, die „blinde Kunstkritik“ eine eingehende Analyse: Humorvoll bekämpft Rembrandt sie mit ihren eigenen Waffen, indem er in seiner Radierung die Kunstkritik defäkiert (387) und zeigt, wie Neid am effektivsten zu bekämpfen ist: Ehrlichkeit, Humor und Freundschaft.
Insgesamt erzählt Graul die visuelle Geschichte des Neids und seiner Gegnerschaft und legt einen epochenübergreifenden Einblick in die menschliche Psyche vor. Sie regt an, weit über die Kunstgeschichte hinauszudenken und Neid als anthropologische Konstante ernst zu nehmen. Keine andere Studie macht Neid zum Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen. Zwar existieren Veröffentlichungen über den gegenwärtigen Künstlerneid [3] und theologische Forschungen über die Todsünden in der Frühen Neuzeit.[4] Eine kunsthistorische Untersuchung, die anhand einer Vielfalt von Einzelstudien ein größeres Bild der Diskurs- und Ikonografiegeschichte des Neids in der Renaissance – und besonders Italien – nachzeichnet, hat bislang jedoch gänzlich gefehlt. Insofern bildet Grauls Arbeit dank ihrer detektivischen, ikonografischen Spurensuche vor allem aus Sicht der Kunstgeschichte einen grundliegenden Beitrag zur Renaissanceforschung. Gleichzeitig hält Graul durch ihr philologisches Feingefühl am Neidbegriff und seiner Diskursgeschichte Schätze für Forschende der gesamten Kulturgeschichte, Theologie und Italianistik bereit.
[1] Tatsächlich machen Grauls detaillierte Beschreibungen die Neidikonografie vieler anderer Werke erstmals sichtbar, vor allem innerhalb Mantegnas Oeuvre: in dessen Ecce Homo (ca. 1500) zeichnen sich die von Graul skizzierten Neid-Elemente haargenau ab.
[2] Ein Vergleich von Invidia und Caritas ließe sich gut mit Rebecca Bowens Dissertation über die Ikonografiegeschichte der Liebe ergänzen: Dies., Figures of love: amor from antiquity to the Italian middle ages [PhD thesis], University of Oxford 2020.
[3] Neid / Envy, hrsg v. Katharina Hausladen, Geneviève Lipinsky De Orlov, in: Texte Zur Kunst 31 (2021).
[4] Alexander Merkl, Von Todsünden und Hauptlastern. Rekonstruktionen und Neureflexionen, in: Studien zur theologischen Ethik 159 (2022), Basel; Die sieben Todsünden (Ausst.-Kat.), hrsg. v. Melanie Thierbach, Petersberg 2016.
Graul, Jana: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit (= Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Band 51), München: Hirmer Verlag 2022
ISBN-13: 978-3-7774-4019-4, 480 S., 98,00 EUR, table of contents
Recommended Citation:
Gregor Meinecke: [Review of:] Graul, Jana: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit (= Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Band 51), München 2022. In: ArtHist.net, May 28, 2024 (accessed Mar 6, 2026), <https://arthist.net/reviews/41832>.
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International License. For the conditions under which you may distribute, copy and transmit the work, please go to https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International License. For the conditions under which you may distribute, copy and transmit the work, please go to https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/