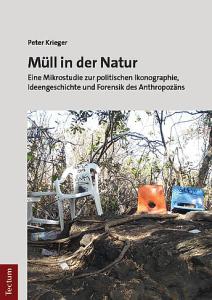Peter Kriegers Buch über die Ästhetiken von Müll aus einer Perspektive des globalen Südens, der überproportional mit den fatalen ökologischen, klimatischen und sozialen Folgen der globalen Müllproduktion konfrontiert ist, erfüllt ein dringendes Desiderat. In der Form einer Mikrostudie wird der Müll des REPSA-Naturschutzgebietes im Süden von Mexiko-Stadt nicht nur als ein global vernetztes Problem dargestellt, sondern auch seine ästhetischen Auswirkungen und Folgen werden ‚bildgewaltig‘ präsentiert.
Der Autor ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Geoästhetik. In diesem Buch setzt er sich intensiv auch mit der ‚natürlich-ästhetisierten-verschmutzten‘ Umgebung seiner Forschungsstätte an der Universidad Nacional Autónoma de México auseinander. Das Instituto de Investigaciones Estéticas, das Institut für Ästhetische Studien, der größten Universität Lateinamerikas liegt inmitten der zum Naturschutzgebiet deklarierten vulkanischen Steinwüste des Pedregal. Diese zeichnet sich einerseits durch eine hohe Biodiversität und als ‚grüne Lunge‘ der Megalopolis Mexiko-Stadt aus, andererseits durch ihre ständige Gefährdung durch reguläre und irreguläre Vermüllung, Vergiftung und Flächenreduktion, auch durch kommerzielle, Investoren-getriebene Architektur, die Krieger selbst als ‚Abfall-Architektur‘ bezeichnet. Krieger thematisiert das Problem aus der Perspektive des kleineren, privaten Maßstabs nicht-sachgemäßer Entsorgung von Müll aus To-Go-Produkten ebenso wie aus der Perspektive des mittleren Maßstabs der illegalen betrieblichen Ablage von Müll, zum Teil von giftigem Sondermüll und Bauschutt. Darüber hinaus hat die REPSA (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel) einen festen Platz in der langen, wenn auch nicht bruchlosen, Kultur- und Kunstgeschichte der Region. Die spezifische Landschaft im Südwesten der Metropole war entstanden, nachdem auf dem Gebiet der Hochkulturen von Cuicuilco und Copilco (ca. 2000-1300 v.Chr.) der Vulkan Xitle ausgebrochen war und das riesige Gebiet mit seiner erkaltenden Lava bedeckt hatte (ca. 400 v. Chr.). In der Kolonialzeit erlangte das Gebiet einen Status als ‚malpaís‘ (badlands), als wüstenartige, karge und unfruchtbare Gegend. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts etablierte sich allerdings auch das durch Sommerhäuser der kolonialen Eliten geprägte San Ángel als Ziel von Ausflügen aus der Metropole und wird in dieser Zeit schon als ländlicher Erholungsort rezipiert. Künstler:innen der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdecken das ‚malpaís‘ schließlich als besonders ‚authentisch‘ und ‚wild‘ und nutzen die Szenerie in Malerei, Grafik und Architektur als Sujets, um spezifisch ‚moderne‘ Formenexperimente durchzuführen. Mit der Situierung des Instituto de Investigaciones Estéticas in ebenjener Umgebung nimmt Peter Krieger in diesem Sinne sowohl eine geoästhetisch-kunsthistorische Reflexion, als auch eine Kritik an einer Kultur des Mülls vor wie schließlich auch eine Selbstverortung als Wissenschaftler im Forschungsfeld und als Bewohner und Nutzer der REPSA.
Der Prolog und das erste Kapitel liefern „Ansätze/Einblicke“ und sind besonders aufschlussreich, weil der Autor seine eigene Aisthesis des nicht-touristischen Ortes theoretisch mit der wissenschaftlichen Analyse verbindet und als Forschungsmethode anwendet. Er stellt den facettenreichen Ausgangspunkt der Verschwendung und des Mülls als allumfassendes Phänomen dar und demonstriert am Beispiel einer paradigmatischen megalopolitischen Akkumulation des Globalen Südens die Dringlichkeit einer bildtheoretischen, bildpraktischen und ästhetisch-kritischen Betrachtung des bedrohlichen Phänomens der planetarischen Vermüllung im Anthropozän.
Kapitel 2 untersucht das globale Problem des sichtbaren und unsichtbaren Mülls und seine Folgen für alle Lebewesen aus der Mikroperspektive der REPSA. Der Autor zeigt Boden, Erdoberfläche/Umwelt, Meere, Luft und Atmosphäre als tiefgreifend von Müllstrukturen durchzogen auf.
Im dritten Kapitel stellt Peter Krieger verschiedene disziplinäre Perspektiven auf das REPSA-Abfallproblem dar und schlüsselt das Phänomen in seiner Bedeutungsvielfalt auf. Dabei verdeutlicht er sowohl die Allgegenwart des Abfalls als auch die absolute Notwendigkeit, aus diesen Perspektiven neu zu denken und unser Handeln zu verändern.
Im folgenden Kapitel 4 konzentriert er sich auf den visuellen Aspekt des Mülls als ästhetisches Phänomen. Die unter der Überschrift „Kunstbetrachtung“ aufgeführte kurze Kunstgeschichte des Mülls verortet das Thema auch in einer longue durée der künstlerischen Betrachtung von Müll und dessen Metamorhose zum Kunstobjekt im ready-made. Der Autor stellt seine Überlegungen zu einer Ikonographie von Müllbildern vor und sieht den Blick auf vermüllte Landschaften in der Tradition politischer Landschaften im Sinne Martin Warnkes.
Kapitel 5 verweist auf das (selbst-)zerstörerische Potenzial des allgegenwärtigen Mülls und zeigt einige künstlerische Ansätze auf, die Müll als Material oder Thema verwenden. Die Frage ist, ob diese Positionen zur Dystopie des Abfalls ein reflexives Denken, vielleicht sogar ein Überdenken des Handelns anregen können. Dieser Gedanke wird im letzten Kapitel vertieft, in dem die „Dystopie“ der Idee der „Utopie“ als einem zukunftsorientierten, hoffnungsvollen Denkraum gegenübergestellt wird. Auch die im gesamten Buch geleistete Sensibilisierung, die kritische Reflexion über die komplexen und vielschichtigen Überlagerungen von Zerstörung, Natur, Kultur und Bild, birgt das Potenzial für ein Umdenken und ein anderes Handeln.
Die 142 Bilder des Buches, künstlerische und nicht-künstlerische, dokumentarische und absurde, eröffnen sowohl eine eigene Ästhetik als auch eine eigene Argumentation. Diese Methode bildlicher Argumentation wird leider zu wenig eingeführt und reflektiert. Auch die fotografische Urheberschaft hätte gewürdigt werden können und sollen.
Der Autor schreibt oft von „wilder Natur“, die dann zerstört wird. Leider wird die Nutzung des ‚Natur‘-Begriffs nicht erläutert und nicht reflektiert, dass zumindest für die letzten Jahrhunderte die heutige REPSA immer schon eine kultivierte Landschaft darstellt. Ein implizit angenommener Zustand urzeitlicher Wildnis, der nicht schon immer durch die Anwesenheit des Menschen kontaminiert war (so zeugen die Ruinen von Cuicuilco im Gegensatz dazu von der langen Kultivierung der Gegend) müsste explizit der Kultur des Mülls - die ja auch eine in gewisser Weise wilde, wuchernde, nicht einzudämmende Praxis darstellt - kontrastiert werden.
Wenn Susanne Hauser in ihren Untersuchungen zu „Metamorphosen des Abfalls“ (2001) Abfall und Müll voneinander scheidet und dem Abfall einen Wert zugesteht, den dieser nach seiner Metamorphose von einem Ding zu etwas, das nicht mehr in gleicher Weise Sinn erfüllt, verkörpern könne (so z.B. für andere Nutzer:innen, als Upcycling-Produkt, als Rohmaterial), so beschreibt sie Müll als Produkt einer Metamorphose von einem Ding zu einem Un-Ding, als absolutes Ende der Verwertbarkeit, als essentieller Rest nach jeder Nutzung. Krieger macht diesen Unterschied nicht, und das mag mit der Situierung in Lateinamerika zu tun haben, wo einerseits Müll viel sichtbarer und im Alltag problematischer erscheint, jedoch auch die Grenzen dessen, was noch anders verwertbar ist, anders gelagert und oftmals nicht strikt definiert sind. An dieser Stelle hätte dem Text eine etwas breitere müll-kulturgeschichtliche Kontextualisierung zwischen instabilen Peripherien und Metropolen, das Verhältnis von Müll und Kunst, Armut und Reichtum gutgetan.
In diesem Sinne hätte auch die Position von Mexiko-Stadts als im Globalen Süden gelegen mehr diskutiert werden können. Auch hier wäre eine Definition dieses ubiquitär genutzten Begriffs hilfreich, da insbesondere lateinamerikanische Städte oft eine dialektisch ambivalente Position zwischen dem „Westen“ und dem „Rest“ (Stuart Hall) einnehmen, bzw. die dualistische Vorstellung von der Welt als klar unterteilt in einen globalen „Norden“ (wo sich Kapital und Macht akkumulieren) und einen globalen „Süden“ (gekennzeichnet durch das Fehlen dieser Parameter und meist durch eine lange Geschichte der Kolonisierung durch den „Norden“) einnehmen. Diese binäre Auffassung lässt die vergleichsweise „frühe“ politische Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien, ihre eigene lange Geschichte der Kunst und des intellektuellen Denkens sowie die internen Kolonisierungspraktiken unberücksichtigt.
Anna Lowenhaupt Tsings viel diskutierter Ansatz (The Mushroom at the End of the World, On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, 2015), in dem sie das Gedeihen von Lebewesen auf kontaminiertem Boden als ästhetisches, kulturelles und geistesgeschichtliches Paradigma diskutiert, wäre sicherlich eine Referenz für das Thema.
Peter Kriegers Reflexionen zu den Ästhetiken von Müll in der Natur leisten grundlegende Arbeit in der Verbindung von naturwissenschaftlich-soziologischen Ansätzen mit solchen der Kunstgeschichte, der Kulturwissenschaften und der Ästhetik und zeigen die Dringlichkeit einer ästhetischen Betrachtung realer Landschaftskontaminierung auf. Das große Verdienst Kriegers ist hier auch das Zusammenbringen der Konzeptionen von Landschaft als nutzbare und endliche Ressource und von Landschaft als ästhetischer Kategorie. Tatsächlich erneuert er Warnkes Lesart künstlerischer Landschaftsdarstellung für das Zeitalter des Anthropozän. Dass er dies aus einer Position der Betroffenheit als Mikrostudie tut, verleiht der Argumentation umso mehr Nachdruck, zeigt es doch einerseits auf, dass niemand - auch der/die Wissenschaftler:in nicht - außerhalb des Szenarios stehen und unbeteiligt bleiben kann, andererseits, dass es im Kleinen auch Möglichkeiten für Veränderung, Besserung und einer Aisthesis geben kann, die das Denken und die Kunst als nicht auf Extraktion beruhende Praktiken in Anschlag bringt.
Krieger, Peter: Müll in der Natur. Eine Mikrostudie zur politischen Ikonographie, Ideengeschichte und Forensik des Anthropozäns, Baden-Baden: Tectum Verlag 2024
ISBN-13: 978-3-8288-4974-7, 276 S., 69,00 EUR, Inhaltsverzeichnis
Empfohlene Zitation:
Miriam Oesterreich: [Rezension zu:] Krieger, Peter: Müll in der Natur. Eine Mikrostudie zur politischen Ikonographie, Ideengeschichte und Forensik des Anthropozäns, Baden-Baden 2024. In: ArtHist.net, 20.05.2024. Letzter Zugriff 28.02.2026. <https://arthist.net/reviews/41831>.
![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.
Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.